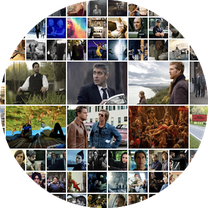Yeah, well, you know, that's just, like, your opinion, man.
The Dude
«The Lost Bus»
Eine Hölle namens Paradise
Action-Zampano Paul Greengrass legt mit «The Lost Bus» Katastrophenkino in Reinkultur vor: atemlos erzählt, atemberaubend fotografiert. Ob all dem handwerklichen Zauber und der kraftvollen Performance von Hauptdarsteller Matthew McConaughey geht fast unter, dass sein auf wahren Begebenheiten basierender Film auch ein paar Schwächen hat.

Apple+
Von Sandro Danilo Spadini
Paradise: In den Ohren von Kevin McKay (Matthew McConaughey) muss der Name seines Heimatorts wie Hohn klingen. 28 Jahre ist es her, dass er nach einem besonders garstigen Streit mit dem
Tyrannenvater der nordkalifornischen 5000-Seelen-Gemeinde den Rücken gekehrt hat. Vor vier Monaten jedoch ist er zurückgekehrt. Der Vater lag im Sterben, und obwohl er zu spät kam, ist er dann
geblieben. Und nun? Liegt sein Leben in Trümmern. Lebt er mit dem ihn hassenden und ihm den Tod wünschenden Teenagersohn und der betagten Mutter (gespielt von McConaugheys Sohn und Mutter) wieder
in seinem Elternhaus. Fährt er einen Schulbus. Hat er Schulden. Liegt er konstant im Clinch mit der Ex. Muss er seinen Hund einschläfern lassen. Durchlebt er einfach grad «zähe Zeiten», wie er
seiner Chefin klagt. Die aber hat nur bedingt Verständnis für Kevin. Denn der ist eher der unzuverlässige Typ. Liefert seine Rapporte stets zu spät ab. Ist immer mal wieder im Rückstand mit der
Wartung seines Fahrzeugs. Und bettelt jetzt schon wieder um Überstunden. Kurzum: Kevin hasst sein Leben. Der Job sei eine Sackgasse. Er quäle sich ab, und trotzdem sei ihm kein Glück vergönnt.
Aber all das ist dann letztlich doch bloss eine geringfügige Unannehmlichkeit gegen das, was an diesem Novembertag im Jahr 2018 auf ihn zukommen wird: das nämlich, was unter dem Begriff «Camp
Fire» als tödlichster und zerstörungswütigster Waldbrand Kaliforniens in die Geschichte eingehen wird. Angefacht von starken Winden, verschlingt die Feuersbrunst in kürzester Zeit massive
Landmassen und umzingelt die Einwohner von Paradise, auf deren Evakuierung sich die gegen die Flammen machtlose Feuerwehr schliesslich konzentrieren muss. Mittendrin in all dem Furor und Terror,
in diesem apokalyptischen Inferno: Kevin und sein gelber Schulbus – mitsamt 22 Kindern und der Lehrerin Mary Ludwig (America Ferrara).
Nah und unmittelbar, aber nie aufdringlich
Und mittendrin sind auch wir. Denn «The Lost Bus» ist der neue Film von Paul Greengrass. Von jenem Action-Zampano also, der uns
in Filmen wie dem 9/11-Meisterwerk «United 93», dem Piratendrama «Captain Phillips» oder dem Utøya-Thriller «22 July» bereits mehrfach namenlosem realem Terror ausgesetzt hat und uns dort wie
auch in seinen Beiträgen zur Bourne-Reihe immer wieder abgrundtief reingezogen hat ins pulsierende Geschehen, auf dass es uns regelmässig den Schnauf abgeschnürt hat. Atemlos ist die Action auch
hier, und das von der ersten Minute an. Zwar dauert es bis knapp zur Hälfte des über zweistündigen Films, bis die Kinder mal in Kevins Bus sitzen und wir so zum Kern der Handlung vordringen. Doch
bereits als die Flammen erst fern am Horizont züngeln und Mary noch meint, dass das «bloss ein weiterer Buschbrand» sei, ist das eine dieser gleichsam immersiven Erfahrungen, die längst zum
Markenzeichen geworden sind des 70-jährigen Regisseurs. Und es ist auch das wieder eine sehr muskulöse Inszenierung, die den Nahkampf sucht, dabei aber immer ein Mindestmass an Zurückhaltung
aufrechterhält – also quasi mit angezogener Handbremse operiert, um im Bild zu bleiben. Entsprechend ist dieses Katastrophenkino in Reinkultur trotz Nonstop-Adrenalinrausch nie tumb und laut, und
es ist trotz aller Nähe und Unmittelbarkeit auch nie aufdringlich, sondern vielmehr auf respektvolle Weise dem Dokumentarischen nahe, dem der ehemalige Journalist Greengrass seit je auch
verpflichtet ist. Dazu passt, dass Matthew McConaughey hier, in seiner ersten «ernsthaften» Arbeit nach sechs Jahren mit allerlei Krimskrams, seine charakteristischen Lausbubenmacken für einmal
sein lässt und stattdessen auf eine so messerscharfe wie kraftvolle Performance setzt. Und dass das im Gegensatz zur Inszenierung eher grobschlächtige Skript, verantwortet von Greengrass und Brad
Ingelsby («The Way Back», «Echo Valley»), seiner Figur etwas gar viel Drama aufbürdet, uns in den ersten gut fünf Minuten schon deren halbe Lebensgeschichte ins Gesicht knallt und ihr auch noch
einen schwer fieberkranken Spross aufhalst, ist schliesslich nicht seine Schuld. Immerhin erwächst daraus ein fruchtbarer Kontrast zwischen dem Schulabbrecher Kevin und der Lehrerin Mary: hier
der Draufgänger, dem es trotz grosser Anstrengung nicht immer gelingt, seine kurze Zündschnur zu verbergen – da die Prinzipienreiterin, die die Dinge kontrolliert, organisiert und strukturiert
anzugehen pflegt. Was die zwei Ungleichen aber eint: Sie haben beide einen 15-jährigen Sohn, von dem sie nicht wissen, wo er ist und wie es ihm geht. Und diese Tragik innerhalb des
feuerbrünstigen Dramas fügt der Geschichte eine weitere Ebene hinzu und jene Schicht, die das alles zusammen und uns bei der Stange hält.
Untrügliches Gefühl für Rhythmus
Denn wiewohl das visuell atemberaubend und handwerklich magistral ist – auch Greengrass’ Werk leidet an jenem in der heutigen Filmindustrie so grässlich grassierenden Makel: Es ist zu lang. Und
das nicht, weil es zu viel erzählen will. Sondern, weil auch hier im Schneideraum geschludert wurde, das überschüssige Fett nicht getilgt, die überflüssigen Verästelungen nicht getrimmt wurden.
Zehn Minuten weniger, und «The Lost Bus» wäre so viel kompakter und stringenter. Und es wäre das nicht nur ein grossartiger, sondern ein meisterhafter Film. Nicht verkehrt ist freilich, dass
Greengrass den Blickwinkel immer wieder erweitert und von der Action rund um den Bus auf die Mühsal der Behörden und Einsatzkräfte lenkt: auf die viel zu knappen Ressourcen, die sie zu einer
Triage zwingen; das ohne jedes Machogedöns auskommende Kompetenzgerangel zwischen jenen, die sich an die Regeln halten wollen, und jenen, die sich auf ihren gesunden Menschenverstand verlassen
oder wenigstens ihr Bauchgefühl; und die Wut darüber, dass das Problem der stetig verheerenderen Waldbrände politisch nicht konsequent angegangen wird. Und schon gar keine Fehlentscheidung war
es, kurz vor dem grossen Finale eine längere Atempause einzuschalten – einen Moment der Ruhe und Reflexion, der nicht nur einige der stupendesten Aufnahmen bereithält, sondern einen auch auf den
Boden zurückholt und wieder mehr sensibilisiert für das unermessliche menschliche Leid, das hier auf dem Spiel steht. Es fügt sich das auch nahtlos in das Bild eines Films, der ein untrügliches
Gefühl für Rhythmus und den passenden Ton hat – eine Fähigkeit, die im unerwartet antiklimaktischen Schlussakkord sogar noch besser zum Tragen kommt, wenn eben nicht die Pauken und Trompeten
ausgepackt werden und zur ohrenbetäubenden Fanfare angesetzt wird und wir stattdessen mit dem Helden sachte wieder zur Besinnung kommen. Auch da sind wir dann wieder mittendrin. Und das, dieser
emotionale Moment, ist eine fast so grosse Kunst wie das Feuerwerk, dass Paul Greengrass davor abgefackelt hat.